Frauenbewegung und die „Satanic Panic“ in den 1990er Jahren
Zeitgenössische Quellen zeigen, dass feministische Aktivistinnen, Therapeutinnen und Opferschutzgruppen eine bedeutende Rolle bei der Verbreitung dieser Moralpanik spielten. Im Folgenden werden die wichtigsten Fakten und Indizien aus den 90ern dazu zusammengefasst.
USA: Feministinnen und die Ausbreitung der Ritualmissbrauch-Panik
In den USA der 1980er und frühen 90er Jahre entstand eine Welle von Anschuldigungen, Kinder würden von satanistischen Kulten rituell missbraucht. Diese Satanic Panic wurde von einer ungewöhnlichen Allianz vorangetrieben. Neben christlich-fundamentalistischen Kreisen und einigen Behörden beteiligten sich auch feministische Fachleute an dem Kreuzzug, der solche Geschichten verbreitete. Wichtig ist der historische Kontext: Die zweite Welle der Frauenbewegung hatte in den 70er/80er Jahren das Thema sexueller Missbrauch von Kindern und Inzest enttabuisiert. Dieses berechtigte Anliegen – Überlebenden zu glauben und Täter zur Rechenschaft zu ziehen – schlug jedoch im Extremfall in Leichtgläubigkeit gegenüber immer fantastischer anmutenden Erzählungen um.
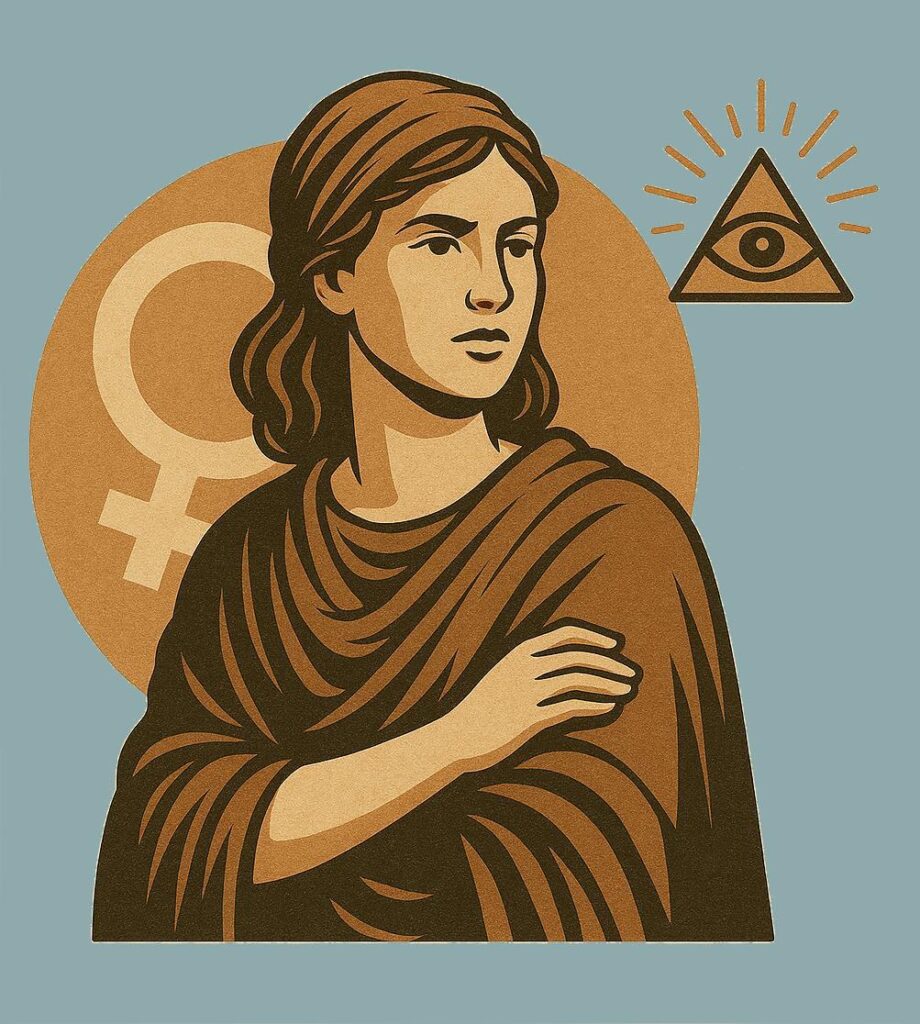
Einige Schlüsselpunkte zur Rolle der Frauenbewegung in den USA:
➔ Allianz mit Professionellen und Aktivisten: Die Satanic Panic wurde laut Untersuchungen als „landesweiter Kreuzzug“ betrieben, an dem neben Sozialarbeiterinnen, Polizisten und religiösen Eiferern explizit auch Feministinnen und Anti-Pornografie-Aktivistinnen mitwirkten openaccess.city.ac.uk . Dieses breite Bündnis verlieh den Verschwörungsgerüchten einen Anschein von Seriosität. Der Soziologe James T. Richardson zählte den Aufstieg des Feminismus als soziale Bewegung sogar zu den zentralen Faktoren, die das Entstehen der moralischen Panik um satanistischen Missbrauch begünstigten.
➔ „Believe the Children“ und Therapeutinnen: Ein Leitsatz vieler feministischer Initiativen war, Opfern unbedingt Glauben zu schenken. Zahlreiche Therapeutinnen und Sozialarbeiterinnen mit feministischer Prägung akzeptierten die extremen Schilderungen ihrer Klientinnen unkritisch, aus Sorge, echte Hinweise auf patriarchale Gewalt könnten sonst übersehen werden. So entwickelte sich eine Industrie von Helferinnen, die auch ohne harte Beweise nach „Anzeichen“ rituellen Missbrauchs suchten. In der Praxis wurden fragwürdige Methoden eingesetzt – etwa suggestive Befragungen von Kindern – um die vermeintliche Verschwörung aufzudecken. Die feministische Grundhaltung, den Schilderungen von Frauen und Kindern grundsätzlich zu vertrauen, ließ dabei selbst bizarrste Anschuldigungen plausibel erscheinen.
➔ Feministische Selbsthilfeliteratur: Ein vielbeachteter Beitrag war das Buch „The Courage to Heal“ (1988) von Ellen Bass und Laura Davis, ein Selbsthilfebuch für Missbrauchsüberlebende. Dieses Werk – in feministischen Kreisen stark verbreitet – ermutigte Frauen, verschüttete Erinnerungen an sexuellen Missbrauch auszugraben. Darin wurde auch die Möglichkeit rituellen Missbrauchs erwähnt. Das Buch wurde international ein Bestseller und war Teil der Bewegung, erwachsenen Frauen zu helfen, sich als Überlebende zu identifizieren. Leider förderte es zugleich die Recovered-Memory-Welle, bei der Therapeutinnen (häufig mit feministischer Grundhaltung) unbewusste Missbrauchserinnerungen „hervorholten“ – ein Ansatz, der viele unbewiesene Ritualmissbrauchs-Erzählungen produzierte.
Zusammengefasst trug in den USA die Frauenbewegung insofern zur Satanic-Panic-Mode bei, als dass feministische Aktivistinnen und Therapeutinnen aus echtem Engagement gegen patriarchale Gewalt diese bizarren Missbrauchsverschwörungen nicht nur glaubten, sondern aktiv verbreiteten. Ihr Einfluss – etwa in Form von Opferschutzorganisationen, Fachkonferenzen und Publikationen – verlieh den Verschwörungsmythen in den 90ern zusätzliches Gewicht.
Deutschland: Frauenbewegung und rituelle Gewalt in den 90ern
Etwa zeitgleich schwappte das Thema auch nach Deutschland. Anfang bis Mitte der 1990er Jahre stieg das Thema rituelle Gewalt hier zu einem „virulenten, emotional und moralisch hochgradig besetzten“ Diskurs auf. Die Dynamik ähnelte der in den USA: Medienberichte, angebliche Tatsachenbücher, Talkshows und sogar ein Tatort-Fernsehkrimi behandelten das Thema, was die öffentliche Problemwahrnehmung dominierte. Auch in Deutschland spielten engagierte Frauen aus der psychosozialen Arbeit eine zentrale Rolle bei der Verbreitung der Ritualmissbrauch-Erzählungen:
➔ Multiplikatorinnen in Therapie und Beratung: Eine Schlüsselfigur war z.B. die Traumatherapeutin Michaela Huber, die als „treibende Kraft hinter der Rituelle-Gewalt-Theorie“ gilt. Huber und ähnlich ausgerichtete Kolleginnen schulten über Jahre Hunderte von Therapeut*innen darin, rituelle Gewalt hinter den Symptomen ihrer Patientinnen zu vermuten. Viele dieser Fachleute waren Teil der autonomen Frauenberatungsstellen oder Frauenhäuser, die in den 90ern institutionell erstarkten. Die feministische Infrastruktur – von Frauennotrufen bis zu Selbsthilfegruppen – bot somit einen Resonanzraum, in dem Berichte über angebliche satanische Gewalt verbreitet und bestätigt wurden. Kritische Stimmen hatten es schwer, Gehör zu finden, da das Thema emotional aufgeladen und von engagierten Helferinnen besetzt war.
➔ Feministische Medien und Öffentlichkeit: Auch Teile der Frauenbewegungs-Medien stellten sich hinter die Ritualmissbrauch-Erzählungen. Zum Beispiel veröffentlichten Zeitschriften wie EMMA immer wieder Artikel, die davon ausgehen, dass es satanistisch-rituelle Gewalt gegen Frauen und Kinder tatsächlich gibt und dass Skepsis daran ein „blinder Fleck“ der Gesellschaft sei. In einem EMMA-Beitrag von 2025 betont die Autorin etwa, es gebe die „noch immer geleugnete rituelle sexuelle Gewalt gegen Kinder und Frauen“ – eine Haltung, die implizit schon seit den 90ern von vielen feministischen Aktivistinnen vertreten wurde. Solche Publikationen schilderten Details angeblicher Kult-Verbrechen, um die Wahrnehmung für das Thema zu schärfen, und kritisierten Behörden für mangelnden Glauben an die Opfer.
➔ Geschlechterbild der Verschwörung: Bemerkenswert ist, dass die Verschwörungserzählung oft ein klar gezeichnetes Täter-Opfer-Geschlechterbild transportierte, das mit feministischen Deutungsmustern übereinstimmte. Die Opfer der rituellen Gewalt wurden in diesen Berichten überwiegend als Mädchen oder Frauen dargestellt, die in ihrer Kindheit unsägliche Übergriffe erlitten. Die Täter hingegen waren fast immer Männer – ob als Väter, Priester, Sektenführer oder Mitglieder geheimer Bünde. Dieses Narrativ – wehrlose Frau/Kinder vs. sadistische Männer – passte in das feministische Verständnis von sexualisierter Gewalt als Ausdruck patriarchaler Macht. Entsprechend neigten viele Feministinnen dazu, solchen Erzählungen Glauben zu schenken oder sie zumindest nicht von vornherein auszuschließen, da sie die Geschichten als Bestätigung realer Machtstrukturen und Gewaltverhältnisse sehen konnten.
➔ Die „schützende Mutter“-Rolle: In der Frauenbewegung jener Zeit gab es zudem die Figur der engagierten Beschützerin, oft verkörpert durch Therapeutinnen, Anwältinnen oder betroffene Mütter, die sich vehement für die angeblichen Opfer einsetzten. Sie agierten quasi als „schützende Mütter“ für missbrauchte Kinder – und verteidigten deren Aussagen gegen jede Kritik. Ein Beispiel ist die Sozialarbeiterin Cathrin Schauer, die seit den 1990ern Opfer sexualisierter Gewalt betreut. Schauer ist „empört über die Zweifel“, die am Phänomen ritueller Gewalt geäußert werden, und betont, ritueller Missbrauch sei Teil organisierter Pädokriminalität, auch wenn Täter mit satanischen Inszenierungen die Glaubwürdigkeit der Opfer unterminieren würden. Solche Stellungnahmen zeigen, dass viele weibliche Fachkräfte aus dem Opferschutz die Verschwörungserzählung aus Überzeugung mittrugen – in dem Glauben, Kinder vor mächtigen, meist männlichen Täter-Netzwerken schützen zu müssen.
Fazit
Indizien aus beiden Ländern weisen deutlich darauf hin, dass Teile der Frauenbewegung in den 90er Jahren die Verschwörungstheorie vom satanisch-rituellen Missbrauch mit befeuert haben. Feministisch geprägte Fachleute und Aktivistinnen verbreiteten alarmierende Thesen über geheime Kult-Netzwerke – getrieben von der berechtigten Absicht, Gewalt gegen Frauen und Kinder aufzudecken, dabei aber oft ohne belastbare Beweise. Dies verlieh den Ritualmissbrauch-Erzählungen gerade in sozialarbeiterischen und therapeutischen Kreisen Glaubwürdigkeit. Die Annahme, hinter fast jedem Trauma könne ein satanistischer Kult stehen, wurzelte in der feministischen Maxime, den Erzählungen von Überlebenden vorbehaltlos zu glauben. Insgesamt lässt sich sagen: Gut gemeinter Eifer im Kampf gegen patriarchale Gewalt verband sich damals ungewollt mit Verschwörungselementen – was der Satanic-Panic-Bewegung zusätzlichen Auftrieb gab.
Quellen: Viele der obigen Informationen stammen aus zeitgenössischen Untersuchungen und Medienberichten der 1990er. Zum Beispiel analysierten Debbie Nathan und Michael Snedeker 1995 die Hintergründe der Satanic Panic und beschrieben die Beteiligung von Feministinnen an der „landesweiten Kreuzzugsbewegung“. Soziologische Studien (Richardson 1997 u.a.) zählten den Feminismus explizit zu den Faktoren hinter der Ritualmissbrauchs-Panik. In Deutschland dokumentieren u.a. Schmied-Knittel (2001) und Medienberichte, wie sehr das Thema Anfang der 90er auch durch engagierte Therapeutinnen (etwa Michaela Huber) und feministische Publizistik hochgekocht wurde. Nicht zuletzt verdeutlichen aktuelle Rückblicke, z.B. in EMMA, wie sehr die Erzählung vom satanistischen Kult missbrauchter Mädchen in bestimmten Kreisen der Frauenbewegung verankert blieb – als warnendes Beispiel dafür, wie eine Verschwörungstheorie im Mantel des Opferschutzes Verbreitung fand.
Quellenangaben
- Satanic abuse, false memories, weird beliefs and moral panics https://openaccess.city.ac.uk/id/eprint/11871/1/Satanic%20abuse%2C%20false%20memories%2C%20weird%20beliefs%20and%20moral%20panics.pdf
- Rituelle Gewalt – Wikipedia https://de.wikipedia.org/wiki/Rituelle_Gewalt
- Rituelle Gewalt: Ein „Blinder Fleck“ | EMMA https://www.emma.de/artikel/rituelle-gewalt-341739
| Wichtig Für diesen Artikel waren primär wissenschaftliche Debatten verantwortlich, die in den USA geführt werden. Inzwischen habe ich als Feministin weitergehende Recherchen angestellt – und sehe meine These bestätigt: Nicht der Feminismus ist die treibende Kraft hinter dieser Verschwörungstheorie. Vielmehr agiert ein Milieu, das feministische Infrastruktur gezielt nutzt, um eine sakralisierte Tätererzählung zu etablieren – inklusive therapeutischer Operationalisierung. Eine ausführliche Analyse folgt in einem weiteren Artikel. |
